Warum gelten manche Sprachen als „unübersetzbar“?
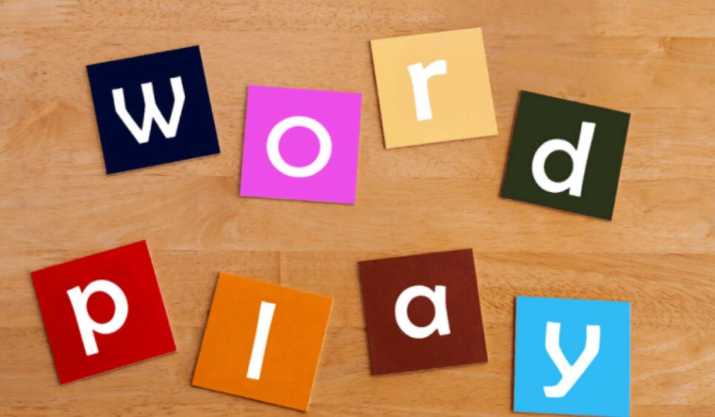
Manche Wörter lassen sich sofort in eine andere Sprache übertragen — „Tisch“, „Sonne“, „lesen“. Andere hingegen sperren sich: Man übersetzt sie, und doch bleibt das Gefühl, als ginge die Hälfte der Bedeutung verloren. Genau solche Wörter und Wendungen haben den Mythos von den „unübersetzbaren“ Sprachen entstehen lassen. In Wahrheit gibt es keine unübersetzbaren Sprachen, wohl aber Realitäten und kulturelle Kategorien, die selbst erfahrenen Übersetzern Kopfzerbrechen bereiten. Schauen wir uns an, warum das so ist und wie die professionelle Übersetzung mit solchen Herausforderungen umgeht.
Woher kommt die „Unübersetzbarkeit“?
Jede Sprache spiegelt eine eigene Denkweise und die kulturellen Werte eines Volkes wider. Während die eine Gesellschaft Dutzende von Begriffen für ein bestimmtes Phänomen entwickelt hat, begnügt sich eine andere mit einer kurzen Wendung — oder Schweigen. Trifft der Übersetzer auf eine solche Asymmetrie, muss er Umwege finden: erklären, umschreiben oder nach dem nächstliegenden Äquivalent suchen.
Beispiel: Das japanische Wort tsundoku bezeichnet die Angewohnheit, Bücher zu kaufen und stapelweise anzuhäufen, ohne sie zu lesen. Im Deutschen gibt es dafür kein eigenes Wort. Der Übersetzer kann die Bedeutung nur erläutern oder den Begriff in seiner Originalform übernehmen und kommentieren.
Kultureller Hintergrund und nationale Besonderheiten
Ein Großteil der vermeintlichen „Unübersetzbarkeit“ liegt im Bereich der Kultur. Wörter sind nicht nur Laute, sondern auch kulturelle Codes.
* Das deutsche Schadenfreude („Freude am Unglück anderer“) veranschaulicht einen allgemein bekannten Gedanken, doch weder im Englischen noch im Russischen gibt es ein einzelnes Wort, das ihn so prägnant wiedergibt.
* Das schwedische lagom beschreibt ein Lebensgefühl der Mäßigung und des Gleichgewichts, weit umfassender als ein schlichtes „Maß halten“ oder „goldene Mitte“.
* Das portugiesische saudade ist ein sehnsuchtsvolles Verlangen nach etwas Unerreichbarem. Ein einziges deutsches Wort reicht hier nicht aus — nur eine Umschreibung kommt der Bedeutung nahe.
In all diesen Fällen steht der Übersetzer vor einer Entscheidung: den Originalbegriff beibehalten, eine Fußnote hinzufügen, erläutern oder anpassen.
Wenn ein genaues Äquivalent fehlt
Nicht der Wortschatzmangel ist der größte Feind der Übersetzung, sondern die Tatsache, dass die Realität, die ein Wort bezeichnet, in einer anderen Kultur schlicht nicht existiert.
So lässt sich das finnische sisu nicht mit „Ausdauer“ oder „Mut“ übersetzen. Es umfasst eine ganze Palette von Eigenschaften: Standhaftigkeit in schwierigen Situationen, unbeirrbares Weitergehen trotz aller Hindernisse. Hier ist eine ausführliche Interpretation unvermeidbar.
Auch das russische Wort toska ist ins Englische eingegangen. Nabokov erklärte einst, dass Begriffe wie melancholy, sadness oder yearning nicht ausreichen, um seine Nuancen wiederzugeben. Auch hier hilft nur die Kontextualisierung.
Interessen des Übersetzers und Ziele des Auftraggebers
Für den professionellen Übersetzer ist es entscheidend, nicht nur die Worte wörtlich zu übertragen, sondern zu bedenken, wie die Botschaft in der anderen Kultur wahrgenommen wird. Besonders wichtig ist dies in der Lokalisierung — der Anpassung eines Textes an eine bestimmte Zielgruppe.
Werbung und Slogans beruhen oft auf Wortspielen. In einer Sprache wirken sie leicht und witzig, in wörtlicher Übersetzung hingegen seltsam oder unpassend. Dann muss der Übersetzer die Botschaft so umformulieren, dass sie bei der Zielgruppe dieselben Emotionen hervorruft und zugleich die Markenwerte bewahrt.
In der Literaturübersetzung ist die Aufgabe noch schwieriger: Die individuelle Stimme des Autors, seine Wortspiele oder dialektalen Eigenheiten lassen sich nicht vollständig übertragen. Doch ein guter Übersetzer findet künstlerische Mittel, die es ermöglichen, den Eindruck des Originals zu erhalten.
Wie Übersetzer mit „unübersetzbaren“ Wörtern umgehen
Es gibt verschiedene Strategien, um sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden:
* Transliteration mit Erklärung — der Originalbegriff wird beibehalten und kommentiert.
* Umschreibende Übersetzung — ein einzelnes Wort wird durch eine ausführliche Definition ersetzt.
* Analogie — man sucht einen möglichst ähnlichen Begriff in der Zielsprache, der zumindest einen Teil der Bedeutung erfasst.
* Neologismus — selten, aber manchmal schafft der Übersetzer einen neuen Ausdruck, wenn dieser den Sinn präzise wiedergibt und eine Chance hat, sich einzubürgern.
Die Praxis zeigt: Manche Fremdwörter werden mit der Zeit im Sprachgebrauch heimisch und verlieren ihren „fremden“ Charakter. Heute wundert sich niemand mehr über Karate oder Pizza — doch auch sie galten einst als „unübersetzbar“.
Warum das für Kunden wichtig ist
Kunden, die eine professionelle Übersetzung beauftragen, verstehen oft nicht, dass ein wörtlich übersetztes Wort noch lange nicht dessen eigentliche Bedeutung wiedergibt. Gerade in der Geschäftskorrespondenz, auf Websites oder in Werbekampagnen ist dies entscheidend: Der Erfolg der Kommunikation hängt davon ab, wie feinfühlig der Übersetzer die kulturellen Nuancen erfasst.
Zum Beispiel:
* Wird ein juristischer Begriff zwar wörtlich übersetzt, passt aber nicht zum Rechtssystem des Ziellandes, drohen Fehler und Missverständnisse.
* Klingt ein Marketing-Slogan unnatürlich, verliert er seine Wirkung beim Publikum.
* Ist ein Text sorgfältig lokalisiert, wirkt er organisch und schafft Vertrauen.
Fazit
Die sogenannten unübersetzbaren Wörter und Ausdrücke zeigen, wie reich und vielfältig Sprache ist. Für den professionellen Übersetzer sind sie kein Hindernis, sondern eine Herausforderung. In jedem Einzelfall gilt es, eine Strategie zu wählen: erklären, anpassen, eine Analogie finden oder den Originalbegriff belassen. Entscheidend sind dabei nicht nur die sprachliche Kompetenz, sondern auch die Aufmerksamkeit fürs Detail, das kulturelle Verständnis und die Berücksichtigung der Kundenwünsche.
So lassen sich selbst die schwierigsten Aufgaben in hochwertige Ergebnisse verwandeln. Deshalb ist es wichtig, Übersetzungen Fachleuten anzuvertrauen, die nicht nur mit Grammatik, sondern auch mit Kultur umgehen können. Wahre Übersetzungskunst besteht darin, dem Leser nicht bloß Worte, sondern den gesamten Sinn, die Stimmung und die Atmosphäre des Originals zu vermitteln.

